Im zweiten geht’s besser Erinnerungen an
By Wolfgang Lenzen
Click here to download the PDF version of this story
Prolog
Das Logo des Furnace Creek 508 erschließt sich erst beim zweiten Hinschauen. Zunächst bleibt der Blick an der altmodischen Westernkutsche und dem Fuhrmann hängen, der mit der Peitsche ein Zweiergespann antreibt; darunter die Zeile „Where the West is Won“. Der Sinn dieser Aussage erscheint aber recht zweifelhaft, denn dass der Wilde Western dereinst in Furnace Creek, einem winzigen Fleckchen im Kalifornischen Death Valley, erobert worden sein soll, lässt sich kaum belegen. Allenfalls möchte dies die Überzeugung eines Chris Kostman darstellen, der sich mit seinem Unternehmen Adventure Corps dem extremen Ausdauersport in einer der extremsten Regionen der Welt verschrieben hat und der alljährlich außer dem Furnace Creek 508 den berüchtigten Badwater Ultra-Marathonorganisiert.
Erst beim zweiten Blick auf das Logo sieht man, dass die Kutsche nicht von Pferden, sondern von Athleten auf Rennrädern gezogen wird. Ihre Aufgabe, den Westen zu erobern, besteht darin, in maximal zwei Tagen 508 Meilen durch das Death Valley und die Mojave Wüste zu radeln. Genauer gesagt beginnt das als „The toughest 48 hours in sport“ annoncierte Rennen am ersten Oktober-Wochenende Samstag morgens um 7 Uhr in Santa Clarita, einem Vorort von Los Angeles, und endet am Montag zur gleichen Zeit in Twentynine Palms, dem touristischen Zentrum des Joshua Tree National Park, ungefähr 200 Kilometer östlich von LA. Wegen einer geänderten Orts durchfahrt beträgt die exakte Länge mittlerweile 509,9 Meilen, d.h. gut 820 Kilometer. Die bloße Angabe der Länge vermag die Schwierigkeit des Wettkampfes jedoch nicht annähernd zu erfassen; der ausschlaggebende Faktor ist die Höhe!
Mit dem Begriff Wüste assoziiert man normalerweise Trockenheit, Hitze und Sand, nicht aber unbedingt Berge. Natürlich gibt es auf der weiten Welt neben eher flachen Wüsten wie der Sahara auch Bergwüsten, die sich – wie etwa die Chilenische Atacama – bis auf eine Höhe von 5.000 Metern über dem Meer erstrecken. Auch weiß man, dass Kalifornien nicht nur aus Pazifikküste und San Joaquin Valley besteht, sondern mit den Rocky Mountains eine den Alpen vergleichbare Bergkette umfasst. Doch die Mojave Wüste liegt ja jenseits der Sierra Nevada, und speziell das Death Valley markiert den tiefsten Punkt der Vereinigten Staaten. Deshalb könnte man erwarten, dass Furnace Creek 508 insgesamt eher flach verlaufen würde. Das folgende Streckenprofil belehrt jedoch eines Besseren.
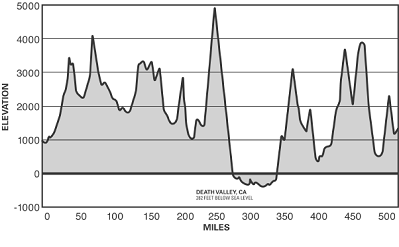
Man beachte freilich, dass das Höhendiagramm nicht in Metern, sondern in Fuß skaliert ist. Der höchste Punkt der Strecke, der Townes Pass, erhebt sich mit 5.000 Fuß also „nur“ auf gut 1.500 Meter, und Badwater, die tiefste Senke im Death Valley, liegt mit „282 Feet below Sea Level“ nur 85 Meter unter dem Meer. Dennoch summieren sich die mit dem Rad zu bezwingenden Steigungen auf rund 10.000 Höhenmeter. Zum Vergleich: Bei einem schweren eintägigen Radmarathon in den Alpen wie dem Ötztaler sind auf einer Länge von gut 200 Kilometern ca. 5.000 Höhenmeter zu bewältigen. Furnace Creek 508 bedeutet somit, auf eine einfache Formel gebracht: Innerhalb von zwei Tagen zweimal den Ötztaler zu fahren, und zusätzlich noch zweimal zweihundert Kilometer flach, und das alles mehr oder minder nonstop.
Zu diesem Begriff ein paar Korrekturen bzw. Erläuterungen. Erstens, die meisten Teilnehmer absolvieren FC 508 als Mitglied einer sich abwechselnden Zweier- oder Vierer-Mannschaft. Von denen fährt jeder nur die Hälfte bzw. ein Viertel der Strecke und kann sich in der übrigen Zeit im Begleitwagen erholen. Einzig die Solofahrer, die Helden der Langstrecke, sind wirklich „nonstop“ unterwegs. Doch auch dies sollte, zweitens, nicht wortwörtlich verstanden werden. Zu Zwecken der Verpflegung, Entsorgung und Hygiene steigt natürlich jeder dann und wann vom Rad, und im Prinzip dürfte man beliebig lange Ruhepausen einlegen. Aber die Uhr tickt unaufhaltsam weiter. „Time is miles“ lautet die Devise, und so gönnen sich Solisten über die ganze Distanz allenfalls zwei, drei Stunden Schlaf.
Auch für die Crew auf dem Kutschbock ist FC 508 kein Zuckerschlecken. Die Leute im Begleitfahrzeug sollen den Athleten einerseits umsorgen und verpflegen; ihn andererseits, wenngleich nicht gerade mit der Peitsche, antreiben und zum Durchhalten motivieren. Schließlich müssen sie dem Sportler während der „Nacht“ – offiziell definiert als Zeitspanne von abends sechs bis morgens sieben Uhr – mit eingeschaltetem Blinklicht und Warnschild ununterbrochen Geleitschutz bieten. Das kann konkret bedeuten, dem Radler während des Aufstiegs zum Townes Pass stundenlang im Schneckentempo hinterher zu kriechen und ihm bei der anschließen den Abfahrt trotz Spitzen geschwindigkeiten von über 80 km/h so dicht wie möglich auf den Fersen zu bleiben, um die Straße mit den Scheinwerfern auszuleuchten. Lediglich tagsüber erfolgt die Unter stützung stressärmer durch „leapfrogging“: Die Begleiter fahren zu einem jeweils vereinbarten Platz voraus, warten dort mit der Verpflegung und können die Pause dazu nutzen, sich auszustrecken, die Gegend zu erkunden und eventuell das Abenteuer per Kamera zu dokumentieren.
Im Übrigen ist das Rennen bis ins Kleinste reglementiert. Zum Beispiel ist Windschattenfahren wie beim Triathlon strengstens verboten, und die penible Vorschrift für das korrekte Verhalten an Stopp-Schildern lautet wie folgt: Das Fahrrad zu einem endgültigen Halt bringen; einen Fuß vom Pedal nehmen und die Straße berühren, mindestens eine Sekunde warten und den vorfahrtsberechtigten Verkehr kontrollieren; erst danach darf weiter gefahren werden. Verstöße werden mit Zeitstrafen bis hin zur Disquali fikation bestraft. Mit dieser Regel sollte ich noch meine Probleme bekommen.
Die Idee
Im Frühjahr 2006 war ich 60 geworden, und es bestand kein Zweifel, dass meine athletische Laufbahn den Zenit überschritten hatte. Allerdings hatte ich mit dem Ausdauersport auch relativ spät angefangen. Immerhin war ich schon jenseits der 40, als ich zum ersten Mal bei einem kleinen Volkslauf an den Start ging. Vor dem ersten Hundert-Kilometer-Lauf in Biel strebte ich schon stramm auf die 50er Marke zu, und den aus meiner subjektiven Perspektive größten Erfolg feierte ich im Alter von knapp 55 Jahren, als ich beim Spartathlon, einen 245 Km Rennen von Athen nach Sparta, in 34:10 h finishte. Im Anschluss an diesen Triumph hätte mich nur noch ein einziger Ultramarathon gereizt, der oben erwähnte Badwater. Dort gilt es, innerhalb einer Ausschlussfrist von 60 Stunden die 135 Meilen lange Strecke von der Talsohle des Death Valley hinauf zum Trailhead des Mt. Whitney zu laufen. Die Hauptschwierigkeiten dieses Laufs sind Steigungen von insgesamt ca. 4.000 Höhenmetern und vor allem die enorme Hitze, die im Death Valley im Juni bis zu 55° C betragen kann. Ich hätte gerne am eigenen Leib in Erfahrung gebracht, ob der Badwater noch schwieriger ist als der Spartathlon. Deshalb bewarb ich mich 2001 um einen Startplatz, erhielt von Chris Kostman auch die Einladung zur Teilnahme, musste wegen orthopädischer Probleme aber absagen.
Schon Jahre zuvor waren im Knie massive Knorpelschäden diagnostiziert worden, die 1996 eine erste Operation erforderlich machten. Zur Regeneration verlagerte ich den Schwerpunkt vom Laufen vorübergehend aufs Radfahren und sammelte in Norwegen erste Erfahrungen im Ultrabereich. „Den Støre Styrkeprøven“ führt über 540 Kilometer von Trondheim nach Oslo. Ich hatte mir das „Magische Ziel“ gesetzt, die Mammutdistanz in einem Tag zu schaffen und finishte sieben Minuten vor Ablauf von 24 Stunden. Mit diesem Ergebnis landete ich übrigens nur irgendwo im Mittelfeld. Während so manche Amateure die zulässigen 44 Stunden voll ausnutzen, bolzen die Schnellsten die Strecke in knapp 14 Stunden herunter! Die Profis fahren dann allerdings auch im Pulk und werden von Begleitfahrzeugen versorgt, so dass sie nicht einmal an den Verpflegungsstellen vom Rad steigen müssen.
2002 wurde die nächste Knie-Operation fällig. Da ich außerdem Probleme mit den Bandscheiben bekam, sagte ich dem Laufen adieu und stieg endgültig aufs Radfahren um. Dabei lernte ich bald die in Frankreich ins Leben gerufene Institution der sogenannten Brevets kennen, die sich durch folgende Merkmale auszeichnen.
- Die 200, 300, 400 und 600 Kilometer langen Strecken sind weder abgesperrt noch markiert; jeder Teilnehmer erhält beim Start eine detaillierte Wegebeschreibung, mit der er den Weg gegebenenfalls alleine finden muss.
- Jeder Fahrer ist für die Verpflegung selber verantwortlich; in der Regel kauft man sich den Proviant in Läden oder an Tankstellen.
- Bei den langen Distanzen sind Nachtfahrten unvermeidlich; wen die Müdigkeit übermannt, der muss sich selber um eine Schlafgelegenheit – notfalls im Straßengraben – kümmern.
- Wer die 200er, 300er, 400er und 600er Strecken im Zeitlimit geschafft hat, ist für die Teilnahme am 1.200 Km Brevet qualifiziert, für das maximal 90 Stunden benötigt werden dürfen.
Bei meinem ersten 1200er, einem landschaftlich herrlichen Kurs durch die Kanadischen Rocky Mountains, brauchte ich 86 Stunden, die sich auf ca. 60 Std. reine Fahrtzeit, dreimal 4 Std. Schlaf sowie 14 Std. sonstige Pausen verteilten. Das bedeutet insbesondere, dass der Netto-Schnitt auf dem Rad nur 20 km/h betrug. Zwar war ich durchaus in der Lage, auf flachen Strecken über viele Stunden einen 25er Schnitt zu halten, doch bei langen Brevets sinkt das Tempo aufgrund der oben genannten Erschwernisse recht drastisch. Hinzu kommt ein in der Regel sehr anspruchsvolles Höhenprofil. So sind in den Rocky Mountains knackige Pässe mit einer Gesamthöhe von ca. 9.000 Metern zu bewältigen, und auch beim Klassiker Paris-Brest-Paris, den ich ein Jahr später in 83 Stunden finishte, addieren sich die zahlreichen Hügel zu einer Summe von 10.000 Höhenmetern.
Vom Furnace Creek 508 hörte ich zum ersten Mal in den USA. Im Herbst 2005 hatte ich bei der Firma PAC-Tour ein „Transcontinental“ gebucht. Im Gegensatz zum Race Across America hat diese Veranstaltung keinen Wettkampfcharakter, sondern man radelt „just for fun“ in 25 Tagen 5.000 Km vom Pazifik zum Atlantik. An einem Abend erzählte mir Tom Zaharis von einem wirklich harten Rennen, das er Jahre zuvor bestritten und nach 45-stündigem Kampf erfolgreich beendet hatte. Nun war Tom nicht nur deutlich jünger als ich, sondern, wie ich täglich registrierte, auf dem Rad auch wesentlich schneller. Von daher hätte ich eigentlich folgern müssen, dass FC 508 für mich eine Nummer zu groß sei. Doch Tom erzählte weiter, dass auch Anne Schneider an diesem Rennen teilgenommen, ja sogar mehrmals gefinisht habe! Da die 57-jährige Anne während des Trans continental ein ähnliches Tempo fuhr wie ich, schöpfte ich Mut und beschloss, FC 508 im nächsten Jahr selber zu probieren.
Erster Anlauf 2006
Wie der Badwater ist auch FC 508 ein Einladungsrennen, für das man sich mit einer überzeugenden ausdauersportlichen Visitenkarte bewerben muss. Ende März traf die erhoffte Bestätigung ein. Unter dem Totem „Tasmanian Wolf“ dürfte ich am 6. Oktober an den Start gehen. In den folgenden Wochen stellte ich die Begleitmannschaft zusammen und buchte frühzeitig die Flüge.
Die Trainingsvorbereitungen nahm ich sehr ernst und absolvierte schon in den Wintermonaten größere Kilometerumfänge, bei schlechtem Wetter auch auf dem heimischen Ergometer. Bis zum Juni hatte ich 6.000 Km in den Beinen und fühlte mich fit für eine Generalprobe. Beim „Støre Styrkeprøven“ würde ich erneut versuchen, an einem Tag 540 Km durch Norwegen zu radeln; dann müsste es doch möglich sein, in zwei Tagen die 820 Km durch die Kalifornische Wüste zu schaffen. Obwohl seit der „Kraftprobe“ von 1996 ein ganzes Jahrzehnt verstrichen war und meine Leistungsfähigkeit physiologisch um fast 10 % gesunken sein musste – tatsächlich war meine Netto-Geschwindigkeit von vormals 26 auf nun gut 24 km/h zurück gegangen –, erreichte ich das Ziel in Oslo wiederum vor Ablauf von 24 Stunden. Das war nur dadurch möglich, dass ich die Pausen kürzte. Hatte ich als 50-jähriger noch gut drei Stunden außerhalb des Sattels verbracht, waren es jetzt deutlich weniger als zwei. Auf der Basis dieser Daten wagte ich für FC 508 folgende Hochrechnung: Wegen der um 50 % längeren Distanz sowie der Erschwernis, nicht im Schutze einer Gruppe, sondern in Solomanier fahren zu müssen, würde das Durchschnittstempo um mindestens zwei km/h absinken. Aufgrund des extremen Streckenprofils wären weitere zwei km/h abzuziehen. Damit käme ich auf einen Schnitt von ca. 20 km/h, den ich ja auch von den 1200er Brevets gewohnt war. Wenn ich auf größere Verpflegungs- und Schlafpausen verzichtete, könnte ich 41 Stunden nach dem Start, d.h. sonntags gegen Mitternacht, ins Ziel kommen. Auf die Crew und mich würden dann in Twentynine Palms zwei bequeme Hotelzimmer warten.
Wegen beruflicher und familiärer Ver pflichtungen fiel es jedoch schwer, die Form aus dem Frühsommer über die Ferienmonate hinweg zu konservieren. Zwar packte ich im September noch einmal 2.500 Trainingskilometer drauf, trotzdem war ich Anfang Oktober nicht in optimaler Verfassung. Das Rennen lief vom Start an irgendwie „unrund“. Bereits auf der ersten Etappe, speziell beim „Windmill climb“, einem Anstieg zu einem Komplex von Hunderten pfeifender Windräder, musste ich hart kämpfen, denn die Prognose aus der offiziellen Strecken beschreibung: „Over seven miles, you’ll climb 1000 feet, probably into a stiff headwind“ sollte sich leider bewahrheiten: Der Gegenwind war ganz schön heftig!

Gegen Mittag erreichte ich den ersten Kontrollpunkt California City. Für 132 Kilometer hatte ich gut sechs Stunden benötigt. Damit lag ich zwar noch im Rahmen meines Fahrplans, doch nur sehr knapp. Das Hauptproblem der folgenden Etappe war nicht mehr der Gegenwind, sondern die aufkommende Hitze. Obwohl mich die Crew so gut wie möglich mit Getränken versorgte, traf ich nach Einbruch der Dunkelheit ziemlich ausgedörrt am zweiten Checkpunkt Trona ein. 245 Kilometer waren geschafft, doch dafür hatte ich einen „vollen“ (halben) Tag, also ein Viertel der insgesamt zur Verfügung stehenden Zeit aufgebraucht!
Eigentlich hätte ich nun ordentlich essen sollen, denn vor uns lag die Königsetappe über den Townes Pass nach Furnace Creek. Doch ich drängte zur Eile: Tanken, schnell was trinken, und weiter geht’s! In stockdunkler Nacht galt es zunächst, einen „1000 foot climb up the Trona Bump“ zu bewältigen. Auf diesem Teilstück gelang es mir sogar, einen Konkurrenten – bzw. genauer: eine Konkurrentin – zu überholen. Der Wahrheit zuliebe muss allerdings ergänzt werden, dass Emily „Archaeopteryx“ O’Brien in der Kategorie „Solo Fixed Gear“, also ohne Gangschaltung bzw. genauer mit starrer Nabe, unterwegs war! Bei der anschließenden Abfahrt schöpfte ich wieder etwas Kraft, die ich für den bevorstehenden Anstieg zum Townes Pass einzusetzen gedachte. Doch erst einmal musste ein knapp 50 Kilometer langer Abschnitt durch das Panamint Valley überwunden werden, der mich wegen des absolut miserablen Straßen belags mit unzähligen Schlaglöchern lauthals fluchen ließ.
Bei Kilometer 320 biegt man scharf rechts auf den Highway 190 East ab. Plötzlich sieht man in der Ferne eine Kette von roten Glühwürmchen. Es sind die Rücklichter der anderen Begleit fahrzeuge, die sich den 10 Meilen langen Aufstieg zur Passhöhe hinaufquälen. Von der Wegbe schreibung her wusste ich, was auf mich zukam: Gut 1.000 Höhenmeter mit Steigungen bis zu 13 %. Ich hatte mein Rad in Osnabrück vorsorglich umrüsten lassen in der Hoffnung, dass mit einem Dreifach-Kranz von 53/39/29 Zähnen vorne und einem Ritzelpaket von 11-26 Zähnen hinten Steigungen bis 15 % kein Problem darstellen würden. Doch es macht einen großen Unter schied aus, ob man einen Pass ausgeruht zu Beginn einer Tagestour angeht, oder im Rahmen des FC 508, wenn man schon 320 Kilometern in den Beinen hat. Jedenfalls reichte bei mir die Kraft an den ganz steilen Passagen nicht aus. Mehrmals musste ich vom Rad und schieben!
Als ich endlich die windige, kühle Passhöhe erreichte, war es schon weit nach Mitternacht. Die Crew hatte in der Zwischenzeit frischen Kaffee gekocht, und ich versuchte die entleerten Energiedepots ein wenig aufzufüllen. Während der folgenden, 25 Kilometer hinab ins Death Valley bräuchte ich ja nicht zu strampeln, also müssten die Kräfte allmählich wieder zurück kehren. Doch die Abfahrt in stockdunkler Nacht war zumindest mental recht schwierig, da selbst meine Brevet erprobte Lichtanlage mit SON-Nabendynamo die kurvige Passstraße nur begrenzt auszuleuchten vermochte. Beth „Dingo“ Dawson, eine frühere Teilnehmerin am FC 508, präzisiert diese Schwierigkeit so:
"The descent from Townes Pass into Stove Pipe Wells dips down in a series of stair-like steps. If you are riding at night, the rider will go over the edge of a dip and plunge into total darkness, a couple of seconds ahead of the van’s lights."
Wenn man über einen der zahlreichen Buckel talwärts rast, strahlen die Scheinwerfer des hinterher fahrenden Autos ein paar Sekunden lang in den Himmel, und die Straße vor dem Radler ist für diesen Moment in Dunkelheit gehüllt. Hoffentlich kommt dann keine Kurve! Bis man sie im eigenen Licht erkennen würde, könnte es zum Bremsen zu spät sein!
Ungefähr eine halbe Stunde dauerte die rasante Abfahrt. Als das Rad wieder in Normaltempo rollte und ich die Tretarbeit hätte aufnehmen müssen, fuhr ich an den Straßenrand und stoppte die Crew. Wie sollte es weitergehen? Ich war ziemlich erschöpft, und auch meinen Töchtern Angelika und Barbara sowie ihrem damaligen Freund Peter war die Müdigkeit deutlich anzumerken. Ich kramte das detaillierte Streckenprofil der Königsetappe aus der Lenkertasche und zog Bilanz:
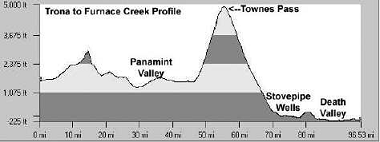
Wir befanden uns noch vor Stovepipe Wells, ungefähr bei Meile 70 dieser Etappe. Zusammen mit den 152 Meilen der ersten beiden Abschnitte waren knapp 360 Kilometer geschafft. Bis zur nächsten Kontrollstation wären noch gut 40 Kilometer zu fahren. Obwohl diese Strecke flach verlief, müsste man zwei Stunden veran schlagen. Es war ungefähr halb drei Uhr; also könnte ich um halb fünf in Furnace Creek ankommen. Dort wäre aber erst knapp die Hälfte der gesamten Strecke absolviert. Um überhaupt eine Chance auf eine Zielankunft zu bewahren, müsste ich den zweiten Teil ohne Schlaf durchfahren, und selbst bei optimistischer Hoch rechnung, den bisherigen Schnitt in etwa halten zu können, hieße das: Frühestens nach 47-48 Stunden würden wir Twentynine Palms erreichen. Für eine Übernachtung in den reservierten Luxus-Zimmern des Best Western Gardens wäre das jedenfalls definitiv zu spät. Vor Antritt der Reise hatte die Crew mir ein rotes T-Shirt überreicht mit dem Aufdruck: „Don’t give up“. Von dieser Motivation war jetzt aber nichts mehr zu spüren. Es regte sich keinerlei Widerspruch, als ich resignierend sagte:
„Lasst uns ins Auto steigen!“
Wenig später fuhren wir den Kontrollposten Furnace Creek an. Ich teilte dem Offiziellen mit, dass ich ausgestiegen sei. Dann legten wir uns am Straßenrand schlafen.
Als ein paar Stunden später der Morgen graute und die Hitze des Death Valley einsetzte, stiegen wir ins Auto und fuhren die restliche Strecke des FC 508 ab. Die Erleichterung darüber, mich nicht weiter quälen zu müssen, überwog dabei den Frust über die Aufgabe. Am frühen Nachmittag trafen wir im Zielort ein, bezogen die Zimmer, erholten uns im Whirlpool und hatten Gelegenheit, das Finish der anderen Radler zu beobachten. Nachhaltig in Erinnerung blieb mir die Ankunft des 60-jährigen Reed Finfrock, der kurz vor der Ziellinie den Rennhelm gegen eine pinkfarbene Kopfbedeckung mit dem Totem „Flamingo“ tauschte und triumphierend in sagenhaften 33:58 h finishte. Spätestens da wurde mir klar: Das FC 508 ist für einen mittelmäßigen Radler wie mich einfach eine Nummer zu groß.
Zweiter Anlauf 2008
Ich weiß nicht mehr genau, wann ich auf die verrückte Idee kam, es doch ein zweites Mal zu versuchen. Im Winter 2007/08 analysierte ich die Gründe für das frühere Scheitern. Der Hauptfehler war die falsche innere Einstellung, mit der ich ins Rennen gegangen war, die trügerische Suggestion, es in 41 Stunden zu schaffen und die mangelnde Bereitschaft, notfalls volle 48 Stunden lang zu fighten, so wie es damals „Archaeopteryx“ mit der starren Nabe vorexerziert hatte. Die 24-jährige Emily fuhr im Großen und Ganzen mein Tempo; überquerte praktisch zeitgleich mit mir den Townes Pass; machte dann aber beharrlich weiter und erreichte den Checkpoint Furnace Creek frühmorgens um 4:30 h, als ich mich dort schon ausruhte. Sie hingegen kämpfte unbeirrbar weiter und finishte schließlich in 47 ½ Stunden, womit sie sich übrigens in der Spezialdisziplin „Fixed Gear“ sogar für eine Teilnahme am Race Across America qualifizierte.
Um genauer herauszufinden, ob jemand aus meiner Altersgruppe mit ungefähr meinem Leistungsvermögen beim FC 508 bestehen kann, analysierte ich die Ergebnisse von Anne Schneider, der Weggenossin beim 2005er Transcontinental, etwas genauer. Dabei zeigte sich, dass sie als 50-jährige das Ziel in 42 ½ Stunden erreicht und drei Jahre später noch einmal in 45 Stunden gefinisht hatte. Die übrigen Zielankünfte, die für eine Aufnahme in die Hall of Fame reichten, beruhten auf Fahrten im 4er-Team der „Snail Darters“. Daraus folgte, dass ich bei optimaler Trainingsvorbereitung und mit der richtigen mentalen Einstellung durchaus eine kleine Chance haben könnte – ich müsste nur wirklich bereit sein, bis zum Umfallen zu kämpfen. Dass ich (vierfacher) Opa überhaupt noch zu kämpfen in der Lage war, hatte ich jedenfalls 2007 bei einer weiteren Teilnahme an Paris-Brest-Paris bewiesen. Trotz miserablen Wetters, das ca. 30 Prozent aller Teilnehmer zur Aufgabe bewog, und trotz zweier technischer Defekte, deren Reparatur Stunden kostete, finishte ich unter 88 Stunden.
Als Generalprobe für FC 508 suchte ich mir im Juni mit Sliven-Sofia-Varna-Sliven einen sehr speziellen Brevet aus. Während das Teilnehmerfeld beim Klassiker in Frankreich bis zu 5.000 Radler umfasst, gingen in Bulgarien nur handverlesene 15 an den Start! Bereits nach drei Stunden, an der ersten nennenswerten Steigung, hängten die anderen mich ab, so dass ich die folgenden Tage praktisch dauernd alleine fahren musste. Obwohl die Veranstalter sich viel Mühe gegeben hatten, die Wegbeschreibung auch für Ausländer verständlich zu gestalten, verfuhr ich mich bei den Stadtdurchfahrten das eine ums andere Mal. Hinzu kamen die objektiven Schwierigkeiten, vor denen schon im Vorfeld gewarnt wurde: Temperaturen von weit über 30°, ein miserabler Straßenbelag und deftige Anstiege im Rila-Gebirge und über den Balkan, die sich auf gut 11.000 Höhenmeter addieren. Die Tour geriet zum Flop. Zwar erreichte ich die Kontrollstation Madara bei Km 900 noch gut im Zeitlimit, doch dann setzte ein heftiges Gewitter ein. Die Perspektive, bei strömendem Regen im Dunklen auf einer Europastraße mit dichtem Schwerlastverkehr, der mich in der Nachmittagshitze schon total genervt hatte, stundenlang Richtung Varna weiter radeln zu müssen, war einfach zu düster. Ich war froh zu hören, dass im Besenwagen noch ein Platz frei war.
Im Juli und August blieb nur wenig Zeit für Training. Die knapp 700 Kilometer, die ich – auf 8 Tagesetappen verteilt – im Urlaub zusammen mit meiner Frau im Elsass, im Burgund und entlang der Loire radelte, waren allenfalls ein Tropfen auf den heißen Stein. Die Rückreise traten wir von dem berühmten Weinort Chablis aus per Auto an. Mit Karte und Navigationssystem suchte ich eine möglichst kurze Strecke aus, die uns über kleinere Landstraßen zu dem Käseort Chaource, dann Richtung Troyes auf die Autobahn nach Chalons-en-Champagne, weiter über die E50 nach Metz, von dort aus teils über Autobahn, teils über Bundesstraßen entlang der Mosel nach Trier führen würde. Danach würde es einfacher; man bräuchte nur noch dem gut ausgebauten deutschen Autobahnnetz nach Osnabrück folgen, wobei allerdings ein Umweg über Essen eingeplant war, wo wir meine Eltern besuchen wollten. Die Gesamtstrecke betrug ungefähr 820 Kilometer, und es dauerte gut 12 Stunden, bis wir letztendlich zu Hause waren. Viele Leute aus unserem Bekanntenkreis finden es sehr anstrengend, an einem Tag eine so lange Strecke mit dem Auto fahren zu müssen. Für sie dürfte es schlicht unvorstellbar sein, die gleiche Distanz in zwei Tagen mit dem Fahrrad zu bewältigen. Auch mir wurde ein wenig schummerig, als ich am Steuer des Mercedes realisierte, wie lang 508 Meilen sein können.
Nach dem Urlaub blieb ein knapper Monat Zeit, den Trainingsrückstand aufzuholen. Der ehrgeizige Plan sah allmählich steigende Umfänge von 600, 800, 1.000 und 1.200 Kilometern pro Woche vor. Wegen des windigen und teilweise regnerischen Herbstwetters fiel die eine oder andere Trainings einheit aber kürzer aus bzw. wurde ganz gestrichen. Trotzdem kam ich im September auf 2.855 Km, und vor allem die letzten drei Einheiten über 260, 240 und 270 Kilometer, die ich mit einem Schnitt von ca. 24 km/h brutto bzw. 25 km/h netto absolvierte, flößten Selbstvertrauen ein: Auch wenn ich als allerletzter die Ziellinie überqueren, auch wenn ich volle 48 Stunden benötigen sollte, dieses Mal wollte ich beim FC 508 unbedingt finishen!
Am Sonntag, den 28.9., flog ich mit Barbara und ihrem neuen Freund Marc nach Los Angeles. Der Ärger über den miserablen Kundendienst der Lufthansa, der mir am Flughafen Münster/Osna brück für die Mitnahme des Fahrrades nachträglich 150 Euro abverlangte, war bald verraucht. Mit dem preisgünstig gemieteten Kia-Minivan machten wir einen schönen, kompakten Kalifornien-Urlaub, fuhren entlang des Pazifiks auf dem Highway 1 nach San Francisco; weiter zum malerischen Lake Tahoe; und dann in einer großen Schleife durch den Yosemite Nationalpark zurück nach Santa Clarita. Im Travelodge Motel trafen wir mit dem Rest der Crew, Michael und Yvonne, zusammen. Am nächsten Tag wurde das Rad zusammengebaut, Proviant gekauft und der Begleitwagen mit Schildern und Warnlichtern hergerichtet. Die penible Prozedur der Kontrolle und Abnahme zog sich bis in den späten Nachmittag hin; andererseits hatte man so ausführlich Gelegenheit, die Konkurrenz zu beäugen. Abends fand im überfüllten Saal des Plaza Banquet die obligatorische Wettkampfbesprechung statt. Wir ließen die Propa ganda- und Informationsveranstaltung, bei der auch das korrekte Verhalten an Stopp-Schildern noch einmal detailliert demonstriert wurde, tapfer über uns ergehen. Gegen Elf waren wir endlich im Bett – sechs Stunden später würde der Wecker klingeln. Für uns alle war jedes bisschen Schlaf kostbar. Schließlich hatte ich meinen Begleitern wiederholt eingetrichtert, wie hart die kommenden 48 Stunden auch für sie werden würden.
Während wir uns bei den bisherigen Pendeltouren zwischen eigenem Hotel und dem ca. 10 Meilen entfernten Startort regelmäßig verfahren hatten, lief am nächsten Morgen alles glatt. Um 6:20 h erreichten wir den Parkplatz vor dem Hilton Garden und hatten Zeit für ein Gruppenfoto.

Dann wurde es ernst! Um 6:30 h mussten sich die 80 Solisten vor dem Eingang des Hilton Garden aufstellen – die Teams würden erst zwei Stunden später an den Start gehen. Jemand vom Organi sationsteam lief mit seinem Multimedia-Notebook durch die Reihen, filmte und machte letzte Interviews. Die Nervosität stieg. Die Begleitmannschaften machten sich im Konvoi auf den Weg zum ersten erlaubten Unterstützungspunkt. Um 6:55 h wurde die amerikanische Nationalhymne intoniert; pünktlich um 7:00 h erfolgte der Start.
Sobald wir das geschützte Hotelareal verlassen und um ein paar Straßenecken herum die Fahrt in Richtung San Francisquito Canyon aufgenommen hatten, konnten wir genauer einschätzen, welche Wetterbedingungen uns erwarten würden. Tags zuvor hatten wir im Weather Channell aufmerksam verfolgt, dass über dem Pazifik ein schweres Sturmtief lag, das am Samstag in Kalifornien für starke Winde aus West sorgen sollte. Da die erste Hälfte des FC 508 im Wesentlichen in nordöstlicher Richtung verläuft, bedeutete dies zunächst einen frischen Wind von links hinten, der an exponierten Stellen auch mal Sturmcharakter annahm. Meine Crew wartete auf der Höhe des ersten Passes bei Meile 24 und fror. Michael, Marc und die Mädchen befürchteten, dass Wind und Nebel mir zusetzen oder mich demotivieren würden. Umso erfreuter waren sie, als ich nach knapp zwei Stunden den ersten Treffpunkt erreichte und gut gelaunt neuen Proviant verlangte. Die kühlen Temperaturen und das bisschen Nieselregen waren beim Aufstieg kein Hindernis; und der für die Wartenden hässliche Wind war für uns Radler eine willkommene Hilfe.
Da Fahrt- und Windrichtung gleich blieben, war auch der folgende Abschnitt zum Windmill Climb leichter als im Jahre 2006. Fast hätte ich dort aber Probleme ganz anderer Art bekommen. Kurz hinter der Passhöhe, bei Meile 57, biegt die Route rechts in die Oak Creek Road ab. Ich war offenbar in Gedanken woanders und fuhr stattdessen stumpf geradeaus. Zum Glück überholte mich wenig später eine Autofahrerin und signalisierte mir, dass das „the wrong way“ sei. Dankbar kehrte ich um, grämte mich nicht groß wegen der paar verlorenen Minuten und wurde bald mit einer herrlichen Abfahrt belohnt. Zum einen erwies sich der Pass als Wetterscheide: Während zuvor Nebel und Nieselregen dominiert hatten, übernahm nun die Sonne das Kommando. Zum anderen blies der Wind jetzt direkt von hinten, so dass der Tacho trotz des gar nicht so starken Gefälles bis über die 80er Marke kletterte. Gelegentlich machte die Straße jedoch eine kleine Richtungsänderung, wodurch der Rücken- sofort zum Seitenwind mutierte; dann galt es, das Lenkrad verdammt gut festzuhalten.
Im Ort Mojave ist ein relativ stark befahrener Highway zu überqueren, und an der Kreuzung steht unübersehbar ein Stoppschild. Während ich das Rad ausrollen ließ, suchte mein Blick die Reihe der Begleitfahrzeuge ab, die auf der anderen Straßenseite warteten. Wo war die Crew? Plötzlich entdeckte ich den dunkelroten Kia. Barbara winkte und rief mir zu. Ich checkte kurz den Verkehr und fuhr los, ohne den Fuß vom Pedal und den Boden berührt zu haben. Ausgerechnet an dieser Stelle hatten die Organisatoren aber einen Kontrolleur postiert, der mich sofort heranwinkte und den Regelverstoß monierte:
"This may be a time penalty!"
Ich versuchte erfolglos, mich herauszureden, und überlegte zugleich, was das ‚may’ genauer heißen sollte? Würde ich für diese Bagatelle schon eine Zeitstrafe bekommen, oder war es nur eine Ermahnung: „Pass beim nächsten Mal besser auf, sonst könnte es eine Zeitstrafe geben!“
Es blieb keine Zeit, die Frage weiter zu diskutieren. Zunächst einmal galt es, mit frisch gefüllter Trinkflasche die Zeitkontrolle in California City anzusteuern, wo eine richtige Essenspause eingeplant war. Die offizielle Ankunftszeit lautete 12:14 Uhr. Dank der günstigen Windverhältnisse war ich einen 25er Schnitt gefahren und hatte gegenüber 2006 45 Minuten gut gemacht.
Der hügelige, nicht extrem bergige Verlauf der folgenden Etappe war mir vom damaligen Rennen noch gut in Erinnerung, und auch die Nachmittagshitze war ähnlich. Doch was für einen riesigen Unterschied machte jetzt der Wind! Auf den ersten 30 Meilen verläuft die Straße in leichten Wellen tendenziell bergab, und hier fiel der Tacho praktisch nie unter 30 km/h! Der Rückenwind war genial, und zu meinem Hochgefühl trug noch eine kleine Episode bei, die sich an einem Rastplatz abspielte. Während meine Begleitmannschaft mit frischen Getränken auf mich wartete, wurde sie von einer anderen Crew angesprochen:
„Ihr seid doch das Team ‚Tasmanian Wolf’?“
„Ja!“
„Dann ist Euer Fahrer Wolfgang Lenzen?“
„Ja!“
„Dann grüßt ihn mal schön! Ich kenne ihn von seinen anderen ausdauersportlichen Abenteuern her; vor allem durch seine Berichte im Internet und das Buch ‚Magische Ziele’“.
Die Genussfahrt hielt praktisch die ganze zweite Etappe an. Wie stark der Wind an dem Nachmittag blies, erfuhr ich erst richtig, als die Straße ein paar Meilen vor Trona einen Knick um 145° nach links machte. Das Tempo ging schlagartig auf 10 km/h zurück, und ich musste für ein paar Minuten heftigst kämpfen. Dabei drang die Sorge ins Bewusstsein, die den ganzen Tag über schon im Hinterkopf nistete: Was, wenn der Wind weiter anhielt? Hinter Furnace Creek würde sich ja die Fahrtrichtung umkehren. Müssten wir dann den gesamten zweiten Tag gegen den Sturm anfahren?
Die offizielle Ankunftszeit bei der Kontrollstation Trona lautete 16:50 Uhr. Damit hatte ich gut zwei Stunden Vorsprung gegenüber 2006 herausgeholt und durfte mir ein ausführliches Abendmahl gönnen. Der Platz um die Texaco Tankstelle herum war stark frequentiert. Findige Einheimische hatten ein Barbecue aufgebaut und verkauften herzhafte Tacos. Gestärkt – und in eine frische Radhose gekleidet – machte ich mich gegen 17:30 h wieder auf den Weg. Ein wunderbares Licht lag über der Wüsten landschaft; der anhaltende Schiebewind brachte mich noch vor Dunkelheit über den Trona Bump. Auch die Strecke durchs das Panamint Valley, die mich damals so sehr zum Fluchen gebracht hatte, schien plötzlich vom Belag her gar nicht mehr so schlimm. Im Geiste konzentrierte ich mich jedenfalls schon voll und ganz auf den Townes Pass, dessen Fuß wir gegen 21:00 h erreichten. Wie würde es mir dieses Mal ergehen?
Als es zum ersten Mal richtig steil wurde, musste ich wieder runter vom Rad, doch nicht, wie damals, um zu schieben, sondern nur, weil die Gangschaltung klemmte. Marc half mir, die Kette per Hand auf den vorderen dritten Kranz zu legen. Da ich beim heimischen Radel Bluschke zudem den hinteren 26er Rettungsring durch einen 28er hatte ersetzen lassen, konnte ich von da ab die steilen Passagen fast mit einer 1:1-Übersetzung fahren. Auch das war nicht einfach, denn 13 % sind nun einmal objektiv betrachtet steil, und subjektiv noch steiler, wenn man bereits 300 Kilometer in den Knochen hat. Aber im Wiegetritt kämpfte ich mich zäh weiter, wobei das Tempo stellenweise auf sechs oder gar fünf km/h zurückging. Nach zwei Drittel des Anstiegs, in der Gegend des „4.000 Feet“-Schildes, rief mir Michael aus dem hinterher schleichenden Van zu:
„He, Wolfgang, Du solltest mal wieder eine Pause einlegen!“
Eigentlich fühlte ich mich stark genug, die restlichen paar Meilen bis zur Passhöhe durchzutreten; doch andererseits lag ich ja gut in der Zeit, also bogen wir in eine Parkbucht ein. Kaum war ich aus dem Sattel gestiegen, merkte ich, wie erschöpft ich im Grunde war. Der Atem ging schwer, das Herz pochte heftig, und die Beine fühlten sich an wie Pudding. Die Pause war doch keine schlechte Idee gewesen.
Nach zwanzig Jahren Ausdauersport ist der Körper zum Glück darauf trainiert, sich auch nach starken Belastungen innerhalb weniger Minuten so weit zu erholen, dass er mit annähernd gleicher Intensität weitermachen kann. Die ersten Schritte oder Tritte nach dem Stillstand fallen natürlich besonders schwer. Die Muskeln schmerzen, und es dauert eine Weile, bis der Organismus seinen Arbeitsrhythmus wieder gefunden hat. Doch solche physischen Probleme lassen sich insbesondere durch eine passende mentale Einstellung überwinden, und die stimmte in jener Nacht am Townes Pass zu hundert Prozent. Ich wusste, dass ich das Minimalziel für den ersten Tag sicher erreichen würde. In den Monaten zuvor hatte ich zwei Strategien für das Rennen entwickelt. Beiden gemeinsam war die Prämisse, den entscheidenden Kontrollpunkt Furnace Creek, der ungefähr den Wendepunkt der Strecke markiert, spätestens bis 3:30 h zu erreichen. Dann bestünde die erste Option, maximal drei Stunden zu schlafen, so dass für die zweite Hälfte noch volle 24 Stunden übrig blieben. Wenn hingegen das Schlafbedürfnis nicht übermächtig sein sollte, könnte ich bei der zweiten Option noch das Flachstück durch’s Death Valley weiterfahren und so am ersten Tag bis zum Fuß des Jubilee Passes kommen. Dann wären am nächsten Tag nur noch 340 Kilometer zu bewältigen, also in etwa das Pensum, das ich bei mehrtägigen Brevets zu radeln gewohnt war.
Gegen 23 Uhr erreichten wir die stockdunkle Passhöhe. Unzählige Sterne blitzten am Himmel. Der Wind hatte fast völlig abgeflaut, und die Luft war vom Regen, der kurz vorher im Death Valley niedergegangen sein musste, relativ warm und feucht. Ich setze mich kurz ins Auto; ließ mich von der Crew bewirten und bereitete mich geistig auf die Abfahrt vor. Was für eine tolle Überraschung sollte ich auf den folgenden 15 Meilen erleben! 2006 war ich den Pass eher mutlos, kraftlos und ängstlich abgefahren. Dieses Mal war es – man verzeihe einem Senior den Ausdruck der Jugendsprache – einfach geil! Ich war high! High wegen der Endorphine, die das Gehirn bei der letzten Kraftanstrengung des Aufstiegs ausgeschüttet haben musste; high wegen des beglückenden Bewusstsein, den schwierigen Pass geschafft zu haben und zeitlich weit besser im Rennen zu liegen, als jemals zu hoffen war; high schließlich auch wegen des Adrenalins, das bei einer rasanten Abfahrt mit 80 km/h unvermeidlich entsteht. Ich kannte die Strecke recht gut, wusste von damals, dass sich im Dunklen keine gefährlichen Kurven versteckten und ließ deshalb das Rad einfach laufen – 30 Minuten Hochgefühl pur! Angst hatte während der Abfahrt nur Marc. Er bemühte sich am Steuer des Kia, mir so dicht wie möglich auf den Fersen zu bleiben, und dabei schoss ihm wiederholt der Gedanke durch den Kopf:
„Was, wenn Wolfgang mal ins Schleudern kommt oder plötzlich bremsen muss!“
Gegen 1:30 h trafen wir in Furnace Creek ein. Die zwei Stunden Vorsprung, die ich dem Rückenwind vor Trona verdankte, hatte ich auf der Königsetappe also konservieren können, und zum Schlafen war es noch viel zu früh. Leider machte die Chevron Tankstelle einen desolaten Eindruck. Keine warme Suppe, über die ich mich so gefreut hätte; kein kühles Bier, kein gar nichts. Nicht einmal eine funktionstüchtige Toilette gab es. Also fuhren wir nach kurzem Aufenthalt Richtung Badwater weiter. Auch hier, 85 Meter unter Meeresniveau, funkelten die Sterne in voller Pracht, als ich in den pechschwarzen Himmel starrte. Irgendwie fühlte ich mich immer noch high; vielleicht auch deshalb, weil ich nachvollziehen konnte, was die Läufer vor dem Start zum mystischen Ultramarathon hier empfinden. Schade, dass Knie und Bandscheiben dieses weitere, potentielle Kapitel der „Magischen Ziele“ verhindert hatten!
Aus diesen Träumereien wurde ich durch ein ganz anderes Körperteil gerissen. Das schmerzende Gesäß signalisierte, dass es Zeit wurde, neue Zinksalbe aufzutragen und eine frische Radhose anzuziehen. Waschen war in den in der Streckenbeschreibung angekündigten „Bathrooms“ – zwei chemischen Plumpsklos – leider nicht möglich. Dann nahmen wir den nächsten Streckenabschnitt in Angriff. Der Abstieg vom Townes Pass ins Death Valley hatte in der Vertikale 5.000 Fuß betragen. Beim nun bevorstehenden Aufstieg aus dem Death Valley nach Shoshone waren 1.000 Fuß weniger zu überwinden, die sich zudem auf zwei Pässe verteilten. Der Jubilee führt zunächst auf 1.300 Fuß Höhe; es folgt eine Zwischenabfahrt auf 1.000 Fuß; der unmittelbar anschließende Salsberry Pass klettert dann noch einmal auf 3.300 Fuß. Meinem Gefühl nach war der erste, kleinere, aber viel länger als der zweite. Nach fast 22 Stunden ununterbrochenen Radfahrens machte sich eben doch eine gewisse Erschöpfung bemerkbar. Die Nacht war immer noch rabenschwarz, und die Passstraße zog sich unüberschaubar und endlos dahin. Erst gegen 6 Uhr, als der Morgen graute und der Himmel sich im Osten rot färbte, war der Jubilee geschafft. Vor dem Salsberry musste ich unbedingt eine richtige Pause einlegen. Meine Crew richtete mir ein Lager her, ich schlüpfte in den Schlafsack und war innerhalb von 45 Sekunden eingeschlafen.
Bereits eine halbe Stunde später wachte ich wieder auf und fühlte mich einigermaßen erholt. Der nächste, längere, aber nach der Schlafpause viel einfacher zu fahrende Salsberry Pass wartete auf mich. Mit der Leistung der ersten 24 Stunden konnte ich mehr als zufrieden sein. 490 Kilometer lagen hinter, also nur noch 330 vor mir, und dafür stand fast ein ganzer Tag zur Verfügung. Was sollte da noch schief gehen, zumal der befürchtete Gegenwind anscheinend ausblieb! Gut gelaunt stieg ich auf’s Rad, fand ziemlich schnell meinen alten Rhythmus wieder, und konnte mich kurz vor der Passhöhe von der Crew verabschieden. Meine Begleiter sollten schon einmal nach Shoshone vorausfahren, tanken und sich um ein gutes American Breakfast kümmern.
Gerade zur richtigen Frühstückszeit, gegen 9:30 h, betraten wir das Cafe, in dem ich mich schon 2006, nach der Niederlage, mit der Crew gestärkt und getröstet hatte. Leider war dieses Mal noch mehr Sonntagspublikum im Lokal, so dass es ewig dauerte, bis wir unsere Bestellung aufgeben durften. Und es dauerte eine weitere halbe Ewigkeit, bis die leckeren Spanish Omeletts, French Toasts und Waffeln nebst Kaffee und Orangensaft endlich auf dem Tisch standen. Sobald meine Portion verschlungen war, schwang ich mich wieder auf den Sattel. Die Befürchtung, der Wind könnte im Laufe des Tages stärker werden und mir dann ins Gesicht blasen, war nicht aus dem Hinterkopf zu verscheuchen. Auch wenn „nur“ noch 185 Meilen zu fahren waren und noch maximal 21 Stunden zur Verfügung standen, war das Rennen noch längst nicht gewonnen.
Die Temperaturen stiegen schnell über 30°, während wir auf dem Highway 127 gen Südosten fuhren und in der Ferne die bis zu 400 Fuß hohen Dumont Sanddünen bewunderten. Zum Glück war der Ibex Pass, wie in der Streckenbeschreibung erwähnt, wirklich „easy“. Dennoch forderte die Mittagshitze – in Kombination mit dem Schlafdefizit vom Vortag – bald ihren Tribut. Direkt an der Straße richtete Michael mir im Schatten der Heckklappe des Kia geschickt eine Ruhestätte her. Barbara bestand darauf, dass ich mich vor der stechenden Wüstensonne mit Creme Lichtschutzfaktor 50+ schützte, und kaum hatte ich mich auf der Luftmatratze ausgestreckt, fielen schon die Augen zu. Wiederum dauerte der „power nap“ nur rund eine halbe Stunde. Also schnell die Trinkflasche füllen und weiter zur nächsten Kontrollstation ins nur noch knapp 30 Meilen entfernte Baker, dem Ort mit dem berühmten „Größten Thermometer der Welt“.
Nach offizieller Zeitmessung traf ich dort um 14:48 h ein, also in etwa zu der Zeit, die ich mir daheim in der optimistischen „Variante 2 – Ohne Schlafpause“ ausgerechnet hatte. Diesem Plan zufolge sollte ich für die verbleibenden gut 200 Kilometer noch 11 Stunden benötigen, so dass wir nachts gegen 1:30 h das Ziel erreichen würden. Nachdem der befürchtete Gegenwind weiterhin ausblieb, war ich voller Zuversicht. Ich gönnte mir eine längere Verpflegungs pause, genoss das alkoholfreie Bier, das Michael extra für mich beim „Mad Greek“ organisiert hatte, und wechselte ein letztes Mal die Radhose.
Doch von nun ab lief manches aus dem Ruder. Zunächst einmal hatte ich den folgenden Pass, vielleicht auch, weil er nicht einmal einen Namen trägt, völlig unterschätzt. Die offizielle Strecken beschreibung charakterisiert ihn mit einem einzigen Satz:
"Leaving Baker, you climb a gradual but relentless 2500 feet in 20 miles (Mountain Section Eight)."
In den Fahranweisungen findet sich die zusätzliche Information, dass die „average grade“ nur schlappe 2,4% beträgt. Deshalb glaubte ich, den „kleinen Hügel“ locker rauftreten und die gesamte Etappe in drei Stunden bewältigen zu können. Tatsächlich benötigte ich diese Zeit jedoch alleine für den Anstieg bis zur Passhöhe! Es war eine elende Quälerei! Auch wenn es, statistisch betrachtet, wie ein Widerspruch erscheint, stieg die durchschnittlich nur 2,4 % steile Straße meistens 5-6 % an, und bei den weniger steilen Passagen konnte man auch nicht richtig beschleu nigen, denn der Belag war absolut miserabel. Die Straßenbauer scheinen hier allen möglichen Bauschutt in den Asphalt gemischt zu haben, und da die Verbindung von Baker nach Kelso keinerlei verkehrstechnische Bedeutung besitzt, werden Schlaglöcher anscheinend nicht mehr repariert. Der einzige Trost an diesem zähen, nicht enden wollenden Anstieg in der Nachmittagshitze war: Anderen, z. B. der unter dem Totem „Empress Penguin“ startenden Lisa Smith-Batchen, ging es noch schlechter. Die 48-jährige war ungefähr zeitgleich mit mir aus Baker losgefahren; anfangs überholten wir uns ein paar Mal gegenseitig, wenn der andere gerade eine Verpflegungspause einlegte; doch bis zum Etappenziel in Kelso hatte sie eine halbe Stunde auf mich verloren, und danach gab sie auf.
An dem Ekelhügel, wie wir den Pass später tauften, wird man nicht einmal mit einer anständigen Abfahrt entschädigt. Die offizielle Angabe:
„A long descent leads to Kelso at Mile 418“
ist zwar in gewisser Weise korrekt, doch besonders lang ist die Abfahrt nicht. Diese Tatsache, dass sie nur 10 Meilen, also weniger als die Hälfte des Aufstiegs dauert, ist freilich das einzig Gute bei der Abfahrt, denn der katastrophale Straßenbelag malträtiert die Handballen und das Gesäß, und die Schlaglöcher zwingen den Fahrer dazu, in voller Konzentration Slalom zu fahren und immer wieder zu bremsen.
Kelso ist ein unwirtliches Nest im Nirgendwo, erwähnenswert eigentlich nur wegen des Bahnübergangs. Zwei Jahre zuvor hatten wir vom Auto aus verfolgt, wie das Rangieren mehrerer Güterzüge einfach kein Ende nahm und die geschlossene Bahnschranke die Athleten bis zu ¾ Stunden lang am Weiterfahren hinderte. Dieses Problem blieb uns zum Glück erspart. Weit und breit war kein Zug in Sicht. Gegen Einbruch der Dunkelheit erreichten wir den Kontrollposten, meldeten unsere Ankunft und fuhren ohne nennenswerte Pause weiter. An dem Ekelhügel hatte ich gegenüber dem Fahrplan fast 1 ½ Stunden verloren. Das war zwar angesichts des am Vortag gewonnenen Polsters noch nicht dramatisch, doch galt es aufzupassen, damit keine weiteren Zeitverluste das Finish gefährdeten.
Auf der folgenden Etappe häuften sich seltsame Erlebnisse, die ein wenig an die Halluzinationen erinnern, wie sie – durch Schlafmangel verursacht – bei manchen Ultra-Läufern während der zweiten Nacht auftreten. In dem packenden Roman „To the Edge“ berichtet Kirk Johnson:
"Badwater is legendary for its hallucinations. Some of the veterans […] had used the word magic to describe the forces that can arise after hours and days of pushing and prodding at the limits of the mind and body. […] Runners have been known to see cruise ships and flying sheep, dematerialized bicycles and ghost wagons that rumble by through the night in vivid and memorable detail […]. One man in 1997 ran across the Golden Gate Bridge, which had been mysteriously transported […] to the dark empty wastes of Owens Valley. Another man became convinced that the road itself had turned into a giant semiconductor chip." (S. 236)
In meinem Fall waren die Halluzinationen jedoch absolut real. Als erstes der unglaublich dichte Verkehr, der hinter Kelso plötzlich einsetzte. Dabei war Kelso doch, wie erwähnt, ein winziger Fleck im Nirgendwo, und die Straße führte zu einem anderen Nirgendwo, nämlich nicht einmal zu dem Ort Amboy, sondern lediglich zu einer Kreuzung „Near Amboy“, an der die Organisatoren des FC 508 die nächste Kontrolle aufgebaut hatten. Die zweite „Halluzination“ war eine junge, offenbar angekiffte Frau, die uns in vollem Tempo überholte und ihrer Verwunderung über das nächtliche Radler-Gespann mit lautem Geschrei Ausdruck verlieh. Neugierig geworden parkte sie ihr chices Mini Cooper Cabrio ein paar Meilen später am Straßenrand und winkte uns zu. Dass sie dabei den Busen entblößte, weiß ich nur aus Berichten der Crew. Ich hatte keinen Blick für ihre Reize, denn ich befand mich schon auf der Abfahrt vom Granite Pass, und diese Abfahrt hatte in mancherlei Hinsicht selber halluzinatorischen Charakter. Dazu trug vor allem die unglaubliche Länge bei, auf die mich Barbara kurz vor der Passhöhe aufmerksam machte:
„Jetzt hast Du es gleich geschafft, Papa, dann geht es zwanzig Meilen nur bergab!“
Zwanzig Meilen sind immerhin 32 Kilometer, und das bedeutet, wenn man ein Durchschnittstempo von gut 40 Km/h zugrunde legt, 45 Minuten kontinuierliche Schnellfahrt ohne jeden Pedaleinsatz, 45 Minuten lang bremsbereit den Lenker umklammern und sich 45 Minuten lang im Scheinwerferlicht auf den nächtlichen Straßenverlauf zu konzentrieren. Ganz anders als am Townes Pass stellte sich jedoch kein High-Gefühl ein, denn Schulter- und Rückenmuskeln verkrampften zunehmend, und ich musste immer wieder eine Hand vom Lenker nehmen, um abwechselnd den linken oder rechten Arm auszuschütteln. Obwohl ich einerseits dankbar darüber war, zwanzig Meilen dahin fliegen zu können, ohne ein einziges Mal treten zu müssen, wünschte ich mir sehnlich, die Abfahrt möge bald ein Ende finden. Die nächtliche Raserei war irgendwie irreal, u. a. weil sich landschaftlich scheinbar überhaupt nichts veränderte. Selbst der Abstand zu einem weit vorausfahrenden Konkurrenten, zu dessen Rücklicht mein Kontrollblick immer wieder hochging, blieb 45 Minuten lang absolut konstant. Es war ungefähr so, als führe ich auf einem Laufband rasend schnell abwärts und könnte den Notstopp nicht finden.
Die Monotonie wurde nur ein einziges Mal durch eine Erscheinung unterbrochen, die den Eindruck des Irrealen um ein Vielfaches verstärkte. Aus dem Nichts tauchte plötzlich eine Karawane hell beleuchteter Trucks auf, die quer zu meiner Fahrtrichtung auf einem Freeway dahin donnerten. Da ich mich überhaupt nicht daran erinnern konnte, dass das unbedeutende Sträßchen Kelso-Amboy irgendwo die Interstate 40 kreuzt, schoss mir, während ich unter der Autobahnbrücke durchraste, der Gedanke durch den Kopf: Hoffentlich stimmt der Weg! Es wäre eine Katastrophe, wenn wir uns verfahren hätten und ich einen Teil der Abfahrt wieder hinaufklettern müsste!
Wenig später erreichten wir Time Station #7, die letzte vor dem Ziel. Der Offizielle trug in sein Online geschaltetes Notebook 9:22 p.m. als Ankunftszeit ein und eröffnete mir sogleich, dass gegen mich eine Penalty von 15 Minuten verhängt worden sei. Ich war schockiert und verärgert, dass das minimale Vergehen am Stoppschild in Mojave so konsequent bestraft werden sollte, merkte aber bald, dass Lamentieren und Diskutieren nichts half. Also kehrte ich resignierend zu unserem Kia zurück und berichtete der Crew, die mich mit Speis und Trank zu stärken versuchte, von dem Missgeschick. Die Viertelstunde, so dachten wir natürlich alle, würden meiner Finisherzeit am Ende draufgerechnet. Als ich gerade wieder bereit war, auf’s Rad zu steigen, rief der Kontrollposten:
"Another two minutes, and you may leave!"
Ich stutzte erst verblüfft, dann dämmerte es mir. Irgendwo in dem Regelwerk mit den 17 Paragraphen und zig Unterabschnitten stand geschrieben, dass die leichteren, nicht zur Disqualifikation führenden Strafen an der letzten Kontrollstation abgesessen werden mussten! Da die „Zwangspause“ mit der dringend benötigten Erholungspause praktisch zusammenfiel, hatte ich allerhöchstens zwei Minuten verbüßen müssen.
Kurz darauf tauchte jedoch ein weiteres, ernsthafteres Problem auf: Der Kreislauf machte schlapp, und ich brauchte dringend eine Schlafpause. Als die Crew mich nach gut einer Stunde weckte, hatte ich überhaupt keine Lust weiterzufahren. Aber was zählt bei einem solchen Wettkampf, wenn es in die entscheidende Phase geht, schon die Lust. Am ersten Tag hatte die Radlerei, begünstigt durch den Rückenwind, selbst während so harter Passagen wie dem Townes Pass eigentlich immer Spaß gemacht. Spätestens ab dem Ekelhügel jedoch war die Lust der Pflicht gewichen. Ich musste mich einfach weiterquälen, weil ich mir tief im Inneren vorgenommen hatte, solange noch irgendeine Chance bestand zu finishen. Und die Chance, das „magische Ziel“ FC 508 im zweiten Anlauf zu erreichen, war zum Greifen nah. Nur noch einen Pass, den Sheephole Summit, galt es zu überwinden. Danach wartete zur Belohnung eine kleine Abfahrt, und zum Finale blieben gerade mal 20 Meilen locker gen Twentynine Palms zu radeln: „rolling slight uphill to the finish line“, wie es in der offiziellen Streckenbeschreibung so beruhigend hieß. Also stieg ich, Erschöpfung hin, Schlafmangel her, wieder aufs Rad und läutete die Schlussrunde ein. Der „final countdown“ sollte beginnen, von Michael am CD-Spieler durch den Song von Joey Tempest passend untermalt.
Erstaunlicherweise fand ich ziemlich schnell den alten Rhythmus wieder und arbeitete mich den Pass langsam, aber beständig, mit oftmaligem Wechsel in den Wiegetritt hinauf. Gegen 1 Uhr nachts war der Sheephole Summit geschafft. Die Crew freute sich mit mir und gratulierte. Der Rest sollte doch nur eine Formsache sein! Höchstens 30 Meilen bis zum Ziel, und noch fast 6 Stunden Zeit! Doch wenig später wurde die Vorfreude brutal zerstört. Direkt nach der Abfahrt bog die Strecke im scharfen Winkel rechts ab, und ein heftiger Gegenwind blies mir ins Gesicht. Zudem führte die Straße nun wieder kontinuierlich bergan, und der Belag hatte die gleiche katastrophale Qualität wie der Ekelhügel. Obwohl ich die letzten Kräfte mobilisierte, sank der Tacho auf unter 15 km/h. Frustriert stieg ich vom Rad und fragte die Crew, wie lang die Schinderei noch dauern könnte.
„24 Meilen“, verkündete Barbara nach genauem Studium der Unterlagen.
„Das kann doch nicht sein“, erwiderte ich schockiert und wollte mich nicht in mein Schicksal fügen.
„Du musst Dich vertan haben. Schau doch noch mal genau nach!“
„Doch, genau 24 Meilen!“, entgegnete die Tochter, denn sie wollte mich nicht belügen, und leider hatte sie Recht.
Es hätte viele Möglichkeiten gegeben, sich mit dieser bitteren Wahrheit abzufinden. Schließlich sind 24 Meilen nur knapp ein Marathon, und ich hätte mich z.B. an den Spartathlon erinnern können, wo es gilt, innerhalb von 36 Stunden sechs solche Marathons zu laufen. Damals, im Jahre 2000, hatte ich für den letzten Marathon zu Fuß nur ungefähr so viel Zeit gebraucht hatte, wie mir nun, beim FC 508, auf dem Rad noch zur Verfügung stand. Oder ich hätte mich an den Transcontinental erinnern können, als wir an einem ungünstigen Tag in Kansas einen sechsfachen Marathon, fast 250 Km, ununterbrochen Gegenwind hatten. Unter der einen oder anderen Perspektive war es doch ein Klacks, die letzten 24 Meilen auf einer holperigen Straße bergauf gegen den Wind zu radeln. Doch nichts dergleichen ging mir durch den Kopf. Ich fühlte nur Frustration und eine – objektiv eigentlich unberechtigte – Angst, das auf einmal wieder so fern erscheinende Twentynine Palms nicht im Zeitlimit zu erreichen.
Die Crew, selber erschöpft, merkte, wie schlecht es mir physisch und psychisch ging, und versuchte mit steter Anfeuerung und Musik aus dem herunter gekurbelten Fenster so gut wie möglich zu helfen. Zudem gab Barbara alle sechs Minuten – denn so lange brauchte ich in etwa, um jeweils eine weitere Meile zurückzulegen – die als Trost gemeinte Auskunft:
„Jetzt sind es nur noch so-und-so viele Meilen bis ins Ziel!“
Zweieinhalb Stunden dauerte der erbarmungslose Kampf, zweieinhalb Stunden Fluchen:
„So ein Sch…, das darf doch nicht wahr sein!“
Selbst als die Hauptstraße in Twentynine Palms endlich erreicht war, blieben die berauschenden Gefühle, die ich in der Endphase eines langen Wettkampfes oft erlebt hatte, das Runners’ bzw. Bikers’ High, die triumphierende Gewissheit „Du hast es geschafft!“, noch völlig aus. Vielleicht war mein Körper zu übermüdet und zu erschöpft, um überhaupt Emotionen zu empfinden. Der „29 Palms Highway“ führte weiterhin gegen den Wind bergan, und das Ziel wollte und wollte nicht in Sicht kommen. Von 2006 her wusste ich, dass das Best Western ziemlich am Ende der Straße lag, doch dass dieses Ende sich so weit draußen, fast schon außerhalb der Stadtgrenze, befand, wollte ich einfach nicht wahrhaben. Um 4:20 h jedoch war es endlich so weit. Ein Schlenker nach links, und in einem letzten Kraftakt die Hoteleinfahrt hinauf strampeln, wo Christ Kostman mit seinem Team jeden Finisher persönlich begrüßt.

Während die Crew schon lauthals jubelte, realisierte ich erst ganz allmählich, dass die große Heraus forderung, „The toughest 48 hours in sport“, bestanden war. Nach und nach stellten sich matte Gefühle des Glücks und der Erleichterung ein. Für eine kurze Weile musste ich ganz mit mir alleine sein, die müden Arme in den Himmel strecken und mir klar machen: „Du hast es geschafft!“ Dann galt es, der Begleitmannschaft zu gratulieren. Zutiefst dankbar schloss ich Marc, Michael und Yvonne in den Arm. Die bei weitem intensivste Emotion erlebte ich jedoch gemeinsam mit meiner Tochter Barbara. Als wir uns umarmten und ich die Tränen in ihren Augen entdeckte, wurde mir bewusst, wie sehr die letzten Stunden mit mir gelitten hatte und wie sehr sie sich nun mit mir freuen konnte.
Click here to download the PDF version of this story